 |
Ernst Steininger

Band 69 - Band 69 - Band 69 - Band 69

Teil 1 der Trilogie von
Ernst Steininger
Seemann, deine Heimat ist das Meer
á 13,90 €
ebook für 7,49 € oder 10,29 US$
Inhalt:
1. Sie, als Österreicher, wie kommen Sie zur Seefahrt?
2. SCHULSCHIFF DEUTSCHLAND in Bremen
3. Küstenmotorschiff STADERSAND
4. Motorschiff LINZERTOR
5. Motorschiff VEGESACK
6. Turbinenschiff HUGO STINNES
7. Motorschiff HORNBALTIC
8. Motorschiff BREMER BOERSE
9. Turbinenschiff WERRASTEIN
10. Turbinenschiff MOSELSTEIN
Die Printausgabe hat insgesamt 316 Seiten
Rezensionen bei amazon.de
Ein Seemann schildert die Seefahrt vergangener Jahrzehnte. Soweit nichts Neues, solche Berichte las man schon häufiger. Ernst Steininger hat hier aber ein Highlight der Seefahrtsliteratur geschaffen. In dem er sein eigenes Erleben, die realistischen Schilderungen des Seemannsdaseins der 60er Jahre, mit sehr ausführlichen Erläuterungen über historische Hintergründe sowohl der Seefahrt als auch der bereisten Länder und Häfen anreichert. Der Autor erlaubt sich auch immer wieder mal sozialkritische Anmerkungen, die das in weiten Teilen doch sehr verklärte Bild
von der "christlichen Seefahrt" zurecht rücken. Ich bin selbst zehn Jahre zur See gefahren, wenn auch eine Dekade später als Ernst Steininger. Meine eigene Fahrtzeit begann aber noch
auf jenen alten Lloyd-Linienfrachtern, die auch der Autor so trefflich zu schildern weiß. Und in weiten Teilen des u.a. beschriebenen Fahrtgebietes SAWK sah es auch zu meiner Zeit
nicht anders aus als wie im Buch dargestellt. Steininger hat hier nichts beschönigt, und völlig zur Recht spart er auch die "schlüpfrigen" Aspekte des Seemannslebens jener Zeit nicht aus.
Seine Schilderungen über das Leben an Bord sind authentisch, seine eingestreuten Hintergrundinformationen machen das Buch zu einem wahren Zeitdokument. Mit großer Vorfreude erwarte ich nun das Erscheinen von Teil 2 und 3.
B.S.
oder:
Durch Zufall stieß ich bei Amazon auf die Maritime gelbe Buchreihe", die Jürgen Ruszkowski aus Hamburg herausgibt. Zwar bin ich eine Landratte" - ich stamme aus dem tiefsten Binnenland, aus Leipzig - aber meine heimliche Sehnsucht gilt schon seit meiner Kindheit dem Meer. Nichts Schöneres gibt es für mich, als dem Wellenschlag zu lauschen und die Blicke übers Meer schweifen zu lassen...
Diese platonische Liebe" veranlasste mich nun, mir Leseproben aus verschiedenen Bänden dieser Reihe vorzunehmen. Besonders gefesselt hat mich der jüngste Band, den ein Österreicher, also auch eine Landratte, geschrieben hat: Ernst Steininger Seemann, Deine Heimat ist das Meer". Da erzählt der Autor von den Schwierigkeiten, sich seinen Traum vom Meer zu erfüllen - und davon, wie die Wirklichkeit in der Seefahrt aussieht. Das ist spannend und kritisch, aber nicht ohne Humor geschrieben und hat mich neugierig gemacht. Ich werde dieses Buch auf jeden Fall schnell besorgen und freue mich schon jetzt auf die angekündigten nächsten Bände.
Leseprobe:
Ebenfalls unvergesslich bleibt mir folgendes Ereignis: In der Nacht vom 15. auf den 16. Februar 1962 – also in den Tagen der bislang unvergessenen großen Sturmflut – lagen wir auf der Blexen-Reede bei Bremerhaven vor Anker. Wie üblich war unser erstes Anlaufziel ein skandinavischer Ostseehafen. Das heißt, das wir, zunächst von der Weser zur Elbmündung bis Brunsbüttelkoog wollten, zum Nord-Ostsee-Kanal. Schon bei Auslaufen Bremen war uns bekannt, dass „draußen“ nichts Gutes zu erwarten war. Dazu bedurfte es keines Wetterberichtes. Der Wind fegte seit Tagen aus Nordwest über die Nordsee und drückte das Wasser in die Weser und die Elbe. Zu allem Übel war auch noch „Springtide“. Für die Küstenbewohner stellte sich die bange Frage: Werden die Deiche halten?
Was nun unser Schiffchen betraf, so stellte sich die Frage: Wird der Anker halten? Denn bereits während der Nacht waren wir ein gutes Stück vertrieben. Als ich kurz vor Mitternacht auf Wache zog, traute ich meinen Augen nicht: Vor mir türmte sich ein gewaltiger Schiffsbug auf, auf den die BOERSE – mit dem Heck voraus – langsam aber sicher zu trieb. Mein Geschrei brachte unseren Steuermann zwar schnell auf Trapp, was aber vorerst nichts nützte – die Maschine sprang nicht an! Man hatte wohl nicht nur auf der Brücke gepennt. Mit Ach und Krach kam die BÖRSE von dem großen Ankerlieger gerade noch einmal frei, ohne Schaden anzurichten. Inzwischen hatte der Sturm an Stärke zugenommen. Wir ankerten erneut, und um ein neuerliches Vertreiben zu verhindern, ließ man die Maschine klugerweise gleich mitlaufen. Das war auch nötig, denn die Windsbraut jagte wie eine Furie über das flache, ungeschützte Land, und das Wasser stieg und stieg. An der bereits überfluteten Columbus-Kaje versuchten mehrere Schlepper mit vereinten Kräften, ein riesengroßes Schwimmdock in Position zu halten.
Unser Kapitän war – Bremen war ja noch nicht weit weg – noch nüchtern und reagierte vorerst besonnen. Das heißt; er gedachte abzuwarten. Da aber tuckerte auf einmal ein Schwesterschiff der BREMER BOERSE, die „BREMER WAPPEN“, an uns vorbei. Der Alte echauffierte sich über soviel Verantwortungslosigkeit des ihm wohlbekannten Kollegen. Aber als dann nach wenigen Stunden die WAPPEN leicht zerrupft wieder zurückkam – zerfetzte Persenningteile flatterten im Winde, und auch das Rettungsboot, denke ich, war nicht mehr dort, wo es sein sollte – da hatte unser Alter bereits wieder „Oberwasser“!
„Wat, wat sind dat man bloß für Pfeifen, denen werden wir’s zeigen! Anker auf!“ Sprach’s, und niemand widersprach, obwohl für jedermann ersichtlich war, dass der Mann schon wieder dun war. Ich meine, ich hatte schon ein komisches Gefühl im Bauch, aber es war nicht so sehr Angst, was da in mir kribbelte. Da war auch eine gehörige Portion Neugier auf das bevorstehende Abenteuer dabei.
Um es vorweg zu nehmen: Meiner Neugierde wurde Genüge getan! Am Anfang, auf der Außenweser, kämpfte die kleine BOERSE noch tapfer gegen den Wind und die Tide an. Solange wir Wind und Strom von vorne hatten, ließ sich das Schiff auch einigermaßen auf Kurs halten. Wir boxten uns Meile für Meile mühsam durch die in kurzen, bösen Wellen anstürmende See. Der Leuchtturmwärter vom „Rote Sand“, der da oben hoch und trocken saß, mochte sich wohl verwundert gefragt haben, welche Esel sich da mutwillig in Gefahr brachten. Auf der BOERSE blieb mittlerweile kein Auge mehr trocken. Der Sturmwind fegte die Gischt über das Schiff, dass das Wasser wie Hagel gegen die Brückenfenster prasselte. Das überdampfende „grüne Wasser“ klatschte wie ein großer, nasser Lappen auf die Back und über die Ladeluke, um dann hässlich gurgelnd über die Speigatts abzulaufen. Das ging ja noch einigermaßen gut, solange wir den bissigen Wogen nur den schmalen Steven entgegenhielten. Aber wir mussten ja spätestens beim Feuerschiff „ELBE I“ nach Osten abdrehen. Dabei würde es sich nicht vermeiden lassen, den aggressiven Wellen, wenn auch nur für kurze Zeit, die volle Breitseite zu präsentieren. Der inzwischen doch wieder sehr ernüchterte Alte zögerte und zögerte die anliegende Kursänderung immer wieder hinaus – wohl in der Hoffnung, dass jemand daherkäme und sagte: „Wind, sei still!“. Es kam aber niemand daher. Und ganz plötzlich – ich weiß nicht einmal, ob der Grund eine absichtliche Kursänderung, oder ob das Schiff einfach aus dem Ruder gelaufen war – erwischte uns die See voll an der Backbord-Seite. Das war wie eine gewaltige Ohrfeige, die das Schiff aushob und zugleich nach der Steuerbord-Seite hin einfach umwarf. Auf der Brücke gab es kein Halten mehr. Alle Anwesenden, und das waren mehr als sonst üblich, lagen als ein hilfloses Menschenknäuel auf der zum Boden gewordenen Steuerbord-Seitenwand der Brücke. Eingeklemmt und bewegungsunfähig erlebte, durchlebte ich bei vollem Bewusstsein diese ungemütliche, eigenartige Situation. Eigenartig deshalb, weil ich keine richtige Angst verspürte. Ich hatte, glaube ich, gar keine Zeit dazu. Ich spürte, wie das fast zur Gänze auf der Seite liegende Schiff einige Male hin und her wippte und sich dann sprunghaft, wie nach einem schnellen Entschluss, wieder aufrichtete. Natürlich schlug es vorher noch kräftig nach der Gegenseite aus, so dass wir willenlos wie Puppen von einer Ecke zur anderen geschleudert wurden. So schnell und so gut es ging, rappelten wir uns auf und nahmen unsere Posten wieder ein. Der verdatterte Alte gab Order, das Schiff sofort und augenblicklich wieder in die See zu drehen. Das wurde auch sogleich ausgeführt, war aber nur deshalb möglich, weil die Maschine trotz der extremen Schräglage nicht ausgefallen war – das kam schon einem Wunder gleich. Ebenso verwunderlich war es, dass sich niemand an Bord, weder auf der Brücke, noch in der Kombüse oder der Maschine die Knochen gebrochen hatte oder verbrüht, gequetscht oder sonst irgendwie verstümmelt wurde.
Während das Schiff, wenn auch nur für einige Sekunden, die mir aber wie eine Ewigkeit vorkamen, in dieser unmöglichen Position verharrte, hatte ich das Gefühl, im Kino zu sein. Ich wartete gespannt darauf, wie dieser Film wohl enden würde. Ich sah das flach auf der schäumenden See liegende Schiff so quasi von außen, so als ginge mich das Ganze schon gar nichts mehr an. Der Untergang schien unvermeidlich, das endgültige Kentern eine Frage von Sekunden. Da jedoch, im letzten Augenblick, kam dann doch noch jemand vorbei: Mein Schutzengel! Der gab dem Schiff einen kleinen Stipps und…
Und die BOERSE, das brave Schiff, reagierte sofort. Wie ein von einem niederzwingenden Druck befreites Stehaufmännchen schnellte es in die „Senkrechte“ zurück. So wie ich es heute sehe – wobei anzumerken ist, dass ich damals von Stabilitätsberechnungen genau so wenig Ahnung hatte wie unser Fischdampferkapitän – kam dem Schutzengel wahrscheinlich der optimale Abstand des Metazentrums vom Schwerpunkt des Schiffes entgegen. Es bedurfte also eben nur dieses kleinen Stipps in die richtige Richtung. Hätte anstelle meines Schutzengels ein gewisser Kaiser namens Nero das Sagen gehabt, da wäre der Daumen wohl nach unten gegangen. Ehrlich gesagt: Was das gewissenlose Verhalten unseres Schiffsführers betrifft, der hätte auch nichts anderes verdient. Aber – im Leben werden halt mitunter auch die Schuldigen gerettet…
Aber, auch wenn wir nun wieder „obenauf“ schwammen, wir steckten noch immer tief in der Scheiße. Mit halber Kraft hielten wir im rechten Winkel auf die aus Nordwesten anrollenden, vom Sturmwind gepeitschten Wogen zu. Auf diese Weise entfernten wir uns immer mehr von unserem eigentlichen Ziel. Statt die Unterelbe anzusteuern, fuhren wir nun in die offene „Mordsee“ hinaus. Wehe, wir zeigten ihr nochmals unsere verwundbare Breitseite. Wehe, es fiele gar die Maschine aus…
Es folgte eine lange, bange Nacht. Mit dem starken Licht des Suchscheinwerfers beäugten wir die weißen Gischtfahnen der unaufhörlich heranrauschenden Wellen, um sie auch stets im richtigen Winkel anschneiden zu können. Die Nerven waren zum Zerreißen gespannt; die sich einschleichende Müdigkeit bekämpften wir mit Kettenrauchen und Unmengen schwarzen Kaffees. Glücklicherweise flaute im Laufe des folgenden Tages der Sturm ab. Als dann endlich die Wellen etwas flacher und länger wurden und von ihren Kämmen keine Gischt mehr abwehte, entschloss sich der Alte zu einem neuerlichen Wendeversuch. Das klappte soweit auch ganz gut. Mehr ist dazu nicht zu sagen, außer vielleicht, dass wir wohl alle die Arschbacken ganz fest zusammengekniffen hatten.
Jetzt rollten die Wellen von achtern an; das nun schwer zu steuernde Schiff gierte von einer Seite zur anderen. Die See schob das KüMo wie Treibgut vor sich her, und immer wieder wurden wir von größeren Wellen einfach überrollt. Diese – nicht gerade kleinlich in ihrem Zerstörungsdrang – nahmen so ziemlich alles mit, was an Deck und den Aufbauten nicht niet- und nagelfest war. Zwar flogen uns die Abdeckpersenninge der Ladeluke, die wir offensichtlich seetüchtig genug verkeilt hatten, nicht – so wie bei der „Bremer Wappen“ – um die Ohren, aber... Aber als wir dann doch noch in Brunsbüttelkoog ankamen, da fehlten nicht nur alle Rettungsringe und sonstige Dinge, es fehlte auch eines der beiden Rettungsboote. Das „Hotel zum Anker“, in dem ich zu diesem Zeitpunkt Gottseidank nicht mehr logierte, war völlig abgesoffen und vorerst nicht mehr bewohnbar. Trotzdem, wenn man bedenkt, dass diese Geschichte auch anders hätte ausgehen können, dann war das noch ein geringer Preis, den – die Versicherung zu entrichten hatte. Meine Hoffnung allerdings, dass man den Alten nun wenigstens wegen grober Fahrlässigkeit, wenn schon nicht wegen des Suffs, außer Dienst stellte, sollte sich nicht erfüllen. Jedenfalls nicht während meiner „Dienstzeit“ an Bord der BREMER BÖRSE.
---
Band 70 - Band 70 - Band 70 -

á 13,90 €
Bestellung
Ernst Steininger, gebürtiger Österreicher, hatte von frühester Jugend an Fernweh zum Wasser und den Wunsch, zur See zu fahren. 1957 begann er in Bremen mit einem Lehrgang auf dem „SCHULSCHIFF DEUTSCHLAND“ seine Seemannslaufbahn und fuhr danach auf verschiedenen Schiffen und Fahrtgebieten an Deck. Auf einem seiner Schiffe, dem MS „VEGESACK“, begegnete er auch dem durch die Veröffentlichung mehrerer Bücher vielen Seeleuten bekannten Maschinisten Hein Bruns, der ihn für seine weiteren Fahrzeiten wesentlich prägte. Ernst Steininger reflektiert in diesem Band 70 in Fortsetzung des Bandes 69 über seine Seefahrtzeit auf MS RAVENSTEIN und MS INNSTEIN. Dieses Buch erlaubt nicht nur einen guten Einblick in das Leben auf See und in fremden Häfen, wie der Autor es erlebte. Es gibt auch Einblicke in die Geschichte der Seefahrt und die Entdeckungsreisen früherer Seefahrergenerationen.
Inhalt:
Motorschiff RAVENSTEIN
Motorschiff INNSTEIN
Leseprobe:
Die RAVENSTEIN, ein so genannter „Viermaster“, war das älteste unter all „meinen“ Schiffen. Alles, was ich von ihr weiß, ist, dass sie nach Kriegsende als abgesoffenes Schiff aus dem Antwerpener Hafen geborgen und wieder instand gesetzt wurde. Da sich in meinem Seefahrtbuch keine Angaben über den Bruttorauminhalt des Schiffes befinden, kann ich ihre Größe nur relativ beschreiben. Sie war sicher noch etwas größer als die MOSELSTEIN, hatte über 10.000 Ladetonnen und sechs, vielleicht sogar sieben Luken. Jedenfalls waren diese Schiffe – es gab deren drei: RAVENSTEIN, REIFENSTEIN und ROTENSTEIN – für uns Decksleute die arbeitsintensivsten unter allen Lloydschiffen. Trotz dieser Tatsache brauchte sich Herr Pauli, Chef der lloydeigenen Heuerstelle, deswegen keine Sorgen zu machen. Diese alten Stückgutfrachter waren vorwiegend in der Ostasien-Fahrt eingesetzt. Und wer von uns jungen Seelords wollte nicht auch einmal in Singapur, Hongkong und Yokohama gewesen sein? Zwei weitere, weitaus jüngere Lloydschiffe, die „BAYERNSTEIN“ (Band 42 in der maritimen gelb en Buchreihe) – verewigt auf einer Briefmarke, (Michel-Katalog NR. 257) – und die „SCHWABENSTEIN“, die ebenfalls die Ostasienroute fuhren, kamen für mich nicht in Betracht, denn diese waren noble Fahrgastschiffe.
Die RAVENSTEIN war nicht nur das älteste, es war auch das unfallträchtigste Schiff, auf das ich je meinen Fuß gesetzt habe. Dass mir auf ihr während meines dreizehnmonatigen Bordaufenthaltes nichts Schlimmeres passierte, als dass ich mir einen langen Nagel durch die obligate Plastiksandale in den Fuß trat; dass mir auf diesem „vorsintflutlichem“ Schiff körperlich nichts Gröberes passierte, war reine Glückssache. Dabei waren mir aber die Erfahrungen, die ich auf meinem vorhergehenden Einsatz machte, sicherlich von Nutzen. Nicht nur von Nutzen – ich begann zu begreifen, dass man nicht zu allem „Ja und Amen“ sagen könne – und dass man sich wehren müsse! Denn gerade diese Unfallträchtigkeit schärfte so nach und nach meinen Blick für die uns zugemuteten Arbeitsbedingungen, die oft jedem Sicherheitsgedanken blanken Hohn sprachen.
Das äußere Kennzeichen der RAVENSTEIN waren die vier Großmasten, je zwei vor und zwei hinter den Mittschiffsaufbauten. Wenn ich nicht irre, bestand das Umschlagsgeschirr aus mindestens 22 Ladebäumen und ein oder zwei Schwergutbäumen. Das Schiff hatte keines der sonst üblichen zwischen den Ladeluken stehenden Deckshäuser, auf denen normalerweise die Ladewinden montiert waren. Die Winden standen stattdessen lediglich auf einem etwas erhöhten Podest. Das dazu gehörende „laufende Gut“, die ölig verschmierten und oft genug auch noch verkinkten und mit Fleischhaken gespickten „Renner“ und „Faulenzer“ – das sind ganz ordinäre Drahtseile – lag dann während des Hafenbetriebs einfach dazwischen herum. Die Lukenabdeckungen der Laderäume bestanden aus schweren Eisenpontons, die nur mit dem bordeigenen Umschlagsgeschirr oder mit Landkränen anzuheben waren. Bei Bedarf wurden diese einfach in Reichweite zur Luke an Deck abgesetzt. Zur seefesten Lukenabdichtung gehörten dann auch noch ein paar schwere, übereinander aufgezogene Persenninge, die an den Lukensüllen verschalkt, d. h. an den Rändern eingeschlagen und verkeilt werden mussten. Zum Verschalken bedurfte es der Schalkleisten, stabiler Flacheisen in passenden Längen, und natürlich einer Unmenge von Holzkeilen. Dazu kam dann noch pro Luke ein grobschlächtiges, unhandliches Regensegel, das dann auch ständig nur im Wege lag, wenn man es nicht gerade brauchte. Das lose Taugut der Geien, mit denen die Bäume per Hand seitlich bewegt wurden, war auch nicht immer da, wo es sein sollte, nämlich in Buchten aufgeschossen an der Verschanzung hängend. Und selbstverständlich lagen da auch noch längst ausgemusterte Drahtseile an Deck herum, die immer noch als Preventer Verwendung fanden.
Jede Menge Müll, den man im Hafen nicht sogleich los wurde, besonders das in Massen anfallende Stauholz, machten das Hauptdeck während des Umschlagbetriebes zu einer einzigen großen Falle. Alles in allem ein Szenario, das jedem Seeberufsgenossenschaftler Albträume verursacht hätte. Aber von diesen Herren ließ sich damals sowieso keiner blicken, nicht einmal in Bremen. Und die UVV (Unfallverhütungsvorschriften), zusammengefasst als Loseblattsammlung in einem blauen Ringband, verstaubten auf einem Bücherbord im Kartenhaus. Wir Janmaaten dachten wohl, das müsse so sein und machten uns weiter keinen Kopf darüber, jedenfalls so lange nicht, so lange es einen nicht selbst erwischte. Der pummelige, schon etwas ältere griechische Kollege, der von einem Lukenponton beinahe zu Tode gequetscht wurde, war eben schlicht selbst daran schuld, dass er nicht schnell genug aus dem Gefahrenbereich kam. In unseren Augen war er einfach ein Tollpatsch. Quintus Wunderlich, der Junge hieß wirklich so, bekam während der Reinigungsarbeiten im Unterraum einer Luke aus nicht geringer Höhe eine Holzpalette auf seinen ungeschützten Kopf. Quintus war das fünfte Kind eines honorigen Professors und wohl auch das schwarze Schaf in seiner Familie, hatte wohl den Schädel eines Steinbocks. Außer, dass ihm bei dem plötzlichen wuchtigen Schlag aufs Haupt sein funkelnagelneuer Stiftzahn stiften ging, war an und in seinem Kopf nichts Ernsthaftes kaputt gegangen. Das Horn, das für eine Weile seine Stirn zierte, trug er mit Gelassenheit. Die Tatsache aber, dass sein teurer Stiftzahn trotz intensiver Suche nicht mehr auffindbar war, ergrimmte ihn sehr. Derlei Unfälle waren sozusagen während der Aufräumarbeiten an Deck und in den Luken und auch während der Umschlagsarbeiten im Hafen vorprogrammiert. Aber ganz offensichtlich hat das in jenen Tagen keinen Verantwortlichen groß gestört. Und wir, wir jungen Doofis, fielen immer wieder auf die markigen Sprüche der alten Haudegen rein: „Das, was dich nicht umbringt, macht dich nur noch härter“…
Nach dem Mittschiffsaufbau zu urteilen, musste das Schiff schon einmal bessere Zeiten gesehen haben. Die einzelnen Decks waren alle von ganz oben bis ganz unten mit Holz ausgelegt. Ja, sogar auf dem Hauptdeck, auf dem sich die Kabinen der niederen Dienstgrade befanden, war das Eisendeck der äußeren Betriebsgänge mit Holzplanken bedeckt. Auf dem Palaverdeck führte ein ebenfalls mit Dielen ausgelegter Gang rund um das ganze „Haus“. Da hatten vermutlich in Vorkriegszeiten die Passagiere gewohnt. Na, und erst das Boots- und Kapitänsdeck! Alles aus blitzblank geschruppten Holzdielen. Dazu noch die vielen mit Bootslack sorgfältig imprägnierten Türen, die ebenso behandelten Handläufe der Treppen und Relings: alles aus feinstem Mahagoniholz. Na, vielleicht war es auch nur Teakholz, aber immerhin, um das alles in Schuss zu halten, bedurfte es schon einiger Anstrengung. Zuständig dafür waren der Zimmermann und sein Juzi (Jungzimmermann). Hin und wieder wurde auch unsereins mit solch feiner Holzarbeit betraut. Allerdings beschränkte sich das meist nur auf das Abbeizen alter Lackschichten. Das allmorgendliche Schruppen der Holzdecks auf See blieb natürlich uns „Decksbauern“ überlassen.
Trotz der unwahrscheinlich hohen Besatzungsstärke – die Deckscrew allein bestand aus etwa 16 Mann – war da auch immer noch Platz für einige Passagiere, mit denen wir aber so gut wie gar nicht in Berührung kamen. Eine weitere Besonderheit der RAVENSTEIN war, dass sie, sage und schreibe, drei Schrauben hatte. Logischerweise hatte sie demnach auch drei Hauptmaschinen. Aus diesem Grund gab es zum Chief und seinen drei Ingenieuren auch noch gleich drei Ingenieursassistenten. Einer davon war Erwin R., ein Linzer. Erwin, ein quirliger Typ, war ganz begeistert von „seiner“ Maschine. Hin und wieder entführte er mich in seine phantastische „Unterwelt“ und erläuterte mir mit dem Stolz des angehenden Ingenieurs die Funktionen der verschiedensten Aggregate. Vermutlich nahm ich seine Ausführungen gehörig staunend zur Kenntnis. Sobald ich dem Mief des „Kellers“ entronnen war, war ich dann aber immer heilfroh, wieder frische Seeluft um die Nase zu haben. Nein, in der Maschine wollte ich um keinen Preis der Welt Karriere machen. Mein Wunsch war es vielmehr, von ganz oben, von der Schiffsbrücke aus, ein Schiff zu dirigieren.
- - -
Band 71 - Band 71 -
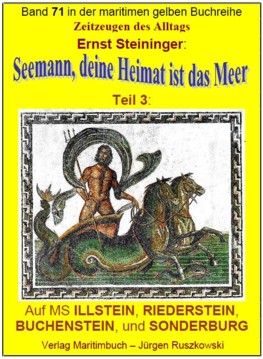
á 13,90 €
Bestellung
Reisen auf den Motorschiffen ILLSTEIN, RIEDERSTEIN, BUCHENSTEIN und SONDERBURG
Ernst Steininger, gebürtiger Österreicher, hatte von frühester Jugend an Fernweh zum Wasser und den Wunsch, zur See zu fahren. 1957 begann er in Bremen seine Seemannslaufbahn und fuhr danach auf verschiedenen Schiffen und Fahrtgebieten an Deck. Ernst Steininger berichtet in diesem Band 71 in Fortsetzung der Bände 69 und 70 über seine Seefahrtzeit auf MS ILLSTEIN mit Reisen nach Mittelamerika Westküste, auf MS RIEDERSTEIN nach Australien sowie auf den Motorschiffen BUCHENSTEIN und SONDENBURG. Dabei erlaubt er nicht nur einen guten Einblick in das Leben auf See und in fremden Häfen, wie er es erlebte. Es gibt auch recht ausgiebig und detailliert interessante Informationen über die Geschichte der Seefahrt dieser Reisegebiete, der angelaufenen Häfen und in die Entdeckungsreisen früherer portugiesischer, spanischer, niederländischer und britischer Seefahrergenerationen..
Inhalt Teil 3 – Band 71
13. Mit Motorschiff ILLSTEIN nach Mittelamerika Westküste
und Brasilien
14. Mit Motorschiff RIEDERSTEIN nach Australien
15. Mit Motorschiff BUCHENSTEIN zur US-Golfküste
16. Motorschiff SONDERBURG
Nachwort
Glossar
Leseprobe:
Wir, die Achtergang, stehen noch immer wegen des Einholens der Schlepptrosse klar. Im Moment ist sie gespannt wie eine Gitarrenseite, der Schlepper zieht das Heck, natürlich samt Schiff, um das an Steuerbord liegende Kaiser-Wilhelm-Höft herum. „Achterschlepper los!“ schallt es plötzlich aus dem Lautsprecher der Wechselsprechanlage. Im selben Augenblick klatscht auch schon die vom Schlepperkapitän per Slip-Haken gelöste Leine ins Wasser. Mit geübten Griffen werfen wir sofort das in Achterschlingen um einen Doppelpoller liegende schwere Drahtseil los, nachdem wir es mit ein paar Törns ums Spill vor dem Ausrauschen gesichert haben.
Kaum ist die Schleppleine im Wasser, will der Alte – von Statur ein kleiner Mann, dafür aber ein ganz großes Nervenbündel – auch schon wissen: „Ist die Schraube klar?“ – „Nein, Schraube ist noch nicht klar!“ antwortet der Zweite dem Lautsprecher. „Ist die Schraube klar?“ – „Nein, Schraube ist noch nicht klar!“ brüllt der Zweite gereizt in den Lautsprecher hinein. Aber aus diesem schallt es unentwegt, zuerst forsch fordernd, dann zunehmend anklagend und schließlich geradezu winselnd zurück: „Schraube klar, Schraube klar, ist die Schraube klar…“
Inzwischen ziehen wir – in „Gänsemarschaufstellung“, Hand über Hand – das nasse, dreckverschmierte, frisch gelabsalbte Stahlseilende mit Muskelkraft durch den Hafengrund an Deck. So eine Schlepperleine kann ganz schön lang und ganz schön schwer sein; dementsprechend kann es schon einige Minuten länger dauern, bis endlich das Auge unterm Schiffsarsch sichtbar wird.
„Ist die Schraube klar, Schraube klar?“ Das unentwegte Gequake und Gewinsel des Alten raubt dem Zweiten seine sonst mit so viel Nachdruck zur Schau gestellte Gelassenheit. Seiner tadellosen Uniform und seiner feinen Lederhandschuhe nicht achtend, reißt er wie ein wild gewordener Matrose nun ebenfalls an der nicht endenden wollenden Stahltrosse. Zwar könnten wir zum Einholen der Leine auch das eigens dafür gedachte Spill verwenden. Aber unser Bootsmann, ein von der Hunte stammender, schollenflüchtiger Kleinbauer, hat wohl eine angeborene Aversion gegen technische Geräte. Also nutzt er jede Gelegenheit, dem „nümodschen Kram“ eins auszuwischen. Und weil ihm die Übersetzung des Verholspills zu langsam ist, heißt es dann: Nix wie ran, und mit „man tau“ und „noch een“ wird wieder einmal mehr „aleman winscha“ geübt…
Endlich klatscht das mit Mudd behängte Auge an Deck. Der Zweite macht einen Satz in Richtung Lautsprecher, schreit lauthals die befreiende Meldung: „Schleppleine ein, Schraube klar!“ in den Trichter. Aus dem ist noch kurz ein letztes Schniefen des Alten und dann die Stimme des Ersten zu vernehmen: „Genug achtern!“ Damit wären wir eigentlich entlassen, aber wie ich unseren Bootsmann einschätze…
Vielleicht sollte ich noch kurz erklären, warum das möglichst schnelle Einholen der achteren Schleppleine von so großer Wichtigkeit ist. Ohne Umdrehungen der Schraube ist das Schiff praktisch manövrierunfähig. Erst der durch die Umdrehungen erzeugte Druck auf das Ruderblatt macht dieses als Steuerelement wirksam. Aber solange sich besagte Stahltrosse in diesem sensiblen Bereich befindet, ist an eine Benutzung des Eigenantriebs nicht zu denken. Zu groß ist die Gefahr, Ruder wie Schraube, die Achillesferse eines Schiffes, zu beschädigen. Von daher ist die Nervosität so mancher Kapitäne während dieser bangen Momente schon verständlich, weil im stark frequentierten Fahrwasser, im versetzenden Strom und womöglich noch bei schlechter Sicht das Schiff quasi gelähmt ist. Weniger verständlich aber bleibt die sinnlose Antreiberei. Aber unser kleiner Kapitän, dessen unüberhörbares „Sächseln“ hinter seinem Rücken immer wieder zur allgemeinen Heiterkeit beiträgt, hat halt nicht mehr die besten Nerven.
Der Bootsmann entlässt uns natürlich noch nicht – wie richtig ich ihn doch eingeschätzt habe! Erst wenn die Leinen „weggeschossen“ sind, dürften wir die Station verlassen. Purer Unsinn! Die Leinen seefest zu verstauen, hätte bei der langen Revierfahrt die Elbe hinunter auch noch bis morgen Zeit. Aber unser Bäuerlein will halt wieder einmal glänzen. „Gut so“, sagt der Zweite und verzieht sich auf die Brücke, um dem Alten sein Sprüchlein aufzusagen: „Achtern alles klar, Herr Kapitän. Der Bootsmann schießt noch eben die Leinen auf.“ Noch eben! Noch eben mal dies, noch eben mal das – dieser biedere Ausdruck noch biederer Bootsmänner hat selbst schon die friedfertigsten Janmaaten zur Weißglut gebracht. Bedeutet er im Klartext doch nichts anderes, als dass eine aufschiebbare Arbeit unnötiger Weise sofort zu erledigen ist, während eine unumgängliche Schwerarbeit gern zur Nebensache verniedlicht wird.
Inzwischen ist es halb vier geworden. Dem Urteilsvermögen des Ersten, na, wahrscheinlich eher dessen Laune, habe ich es zu verdanken, dass ich wieder einmal mehr Vier-Acht-Wächter bin. Während sich meine Kollegen in ihr Logis verdrücken, um bis zum Arbeitsbeginn noch schnell eine Mütze voll Schlaf zu nehmen, versuche ich noch schnell meine Unterarme mit einer Handvoll Twist von der eklig klebenden, übel riechenden Labsalbe zu befreien. Die Labsalbe, was für ein hübsches Wort, ist ein im „Eigenbau“ vom Bootsmann oder von dessen rechter Hand, dem Kabelgatts-Ede, nach uralten Segelschiffs-Rezepten hergestelltes Drahtseil-Konservierungsmittel. Und je nach Dummheit oder Gehässigkeit dieser „Experten“ ist halt dann die Schmiere auch mit mehr oder weniger Tran und Braunteer vermischt.
Wir passieren Toller Ort. Der Vorderschlepper wird entlassen, der Hafenlotse geht von Bord, die Maschine beginnt zu wummern, das Schiff nimmt Fahrt auf. Während ich mich über die Außentreppen auf den Weg nach oben mache, schweift mein Blick noch einmal kurz zurück. Ein Blick zurück, im Zorn? St. Pauli, der Michel, die Landungsbrücken: Im diffusen Lichte der Stadtbeleuchtung, der aufdringlichen Reklamelichter, erscheint mir auf einmal alles irgendwie abgestanden, säuerlich… Hamburg: Tor zur Welt, Stadt der mächtigen Reeder, Stadt der Wirtschafts- und sonstiger Kapitäne, Stadt der Nutten und Lottls, Verteilungslager bajuwarischer, österreichischer, spanischer, türkischer Seefahrer. Hamburg, du alte … – ach scheiß drauf, Scheiß Hamburg…
Leidlich gesäubert melde ich mich auf der Brücke, um sogleich den Rudergänger abzulösen. Mit der üblichen Redewendung „Ich geh dann mal eben nach unten“ – was soviel heißt wie: Ich tauche bis zum Lotsenwechsel in Brunsbüttelkoog erst einmal ab – macht sich der Alte davon. Der an Bord gebliebene Revierlotse ist sichtlich erleichtert, die „Tratschtante“ los zu sein. Er kann sich nun völlig auf seine Arbeit konzentrieren. Sachlich, im ruhigen Ton, gibt er seine Anweisungen an den Rudergänger und an den am Maschinentelegrafen stehenden Offizier. Sie sind schon eine Klasse für sich, diese Revierlotsen. Immerzu mit heiklen Situationen konfrontiert, wirken die meisten von ihnen doch ruhig und gelassen. Ob auf der Elbe, der Weser oder der Schelde, ob auf der Themse, der Seine oder dem Mississippi – ganz egal, auf welchen Revieren auch immer – ihr Beruf verlangt ihnen diese spezifischen Eigenschaften einfach ab: Übersicht, Durchsetzungsvermögen, Entschlossenheit und nicht zuletzt Gelassenheit. Dennoch kann auch der beste Lotse dem Kapitän die Verantwortung nicht abnehmen. Und deshalb wird unser hochgradig nervöser Käpt`n Dietze beim leisesten Furz der Maschine oder nach einer nur etwas zu heftig durchgeführten Kursänderung sofort wieder, wie weiland Rumpelstilzchen, auf der Brücke herumspringen.
Das mache ich jetzt auch. Ich springe zurück in die Gegenwart, um mich aber sogleich wieder von den Erinnerungen an Kapitän Dietze, Hans Ballermann, Rosaria und Paule gefangen nehmen zu lassen. Falls ich es noch nicht erwähnt haben sollte: Das Reiseziel war die Westküste Zentralamerikas. Die Überfahrt bis zum Panama-Kanal verlief für die Jahreszeit – Oktober / November – ganz normal. Das heißt, bis weit über die Azoren hinaus hatten wir das übliche nordatlantische Schweinewetter.
Lesen Sie im Buch weiter!
á 13,90 €
Bestellung
Leseprobe:
Es war also doch nicht bloß ein Latrinengerücht! Unter den üblichen Ausrüstungsgegenständen, die wir in Bremen an Bord nahmen, befanden sich auch eine ganze Menge funkelnagelneuer Schippen. Damit war für jeden erfahrenen Janmaaten das Ziel der Reise ausgemacht. Die handlichen, griffigen Schippen verrieten es: Es geht zum Amazonas! Wie das? Nun, die Schippen waren für das Umschaufeln der zu erwartenden Ladung gedacht – Paranüsse! Und wo, bitteschön, wachsen Paranüsse? Richtig, in Amazonien!
Ich war hellauf begeistert, das war nun einmal ein Trip so ganz nach meinem Geschmack. Bis hoch nach Manaus, vielleicht sogar bis nach Iquitos sollte die Reise gehen. Auf dieser Ausreise überließ ich Paul den „Kusch“ ganz und gar und widmete meine Freizeit interessanteren Büchern. In einer kleinen, feinen Hamburger Buchhandlung hatte ich allerlei Wissenswertes über Brasilien erstanden. Unter anderem auch das von mir schon vielfach erwähnte Buch „20 x Lateinamerika“ von Marcel Niedergang. Daraus habe ich wohl dann auch das allermeiste, was ich bei dieser Gelegenheit zur Geschichte Brasiliens weitergeben möchte, abgekupfert. Folgender Bericht allerdings liegt jenem anderen Bericht zugrunde, an dem ich mich bereits schon vor Jahrzehnten, während einer zehnjährigen Auszeit von der Seefahrt, versucht habe.
Brasilien, Land der Superlative: Wälder, Flüsse, Wasserfälle; Bodenschätze, Megastädte – alles ist gigantisch. Man könnte meinen – und so abwegig ist das nicht – Brasilien sei ein riesiger Schild, der die meisten anderen südamerikanischen Staaten an die Peripherie des Kontinents verdrängt. Auch die Entwicklung des brasilianischen Staatsgebildes verlief völlig anders als die in den spanischen Kronländern. Dafür aber ist es nötig, den „Vertrag von Tordesilla“ zu erwähnen: Der am 7. Juni 1494 – mit päpstlichem Segen – zwischen den beiden Seemächten Portugal und Spanien abgewickelte Kuhhandel hatte nichts Geringeres zur Folge als die Teilung des „Erdapfels“ in eine spanische und eine portugiesische Hälfte. Die Demarkationslinie wurde nach zähem Streit entlang des 46. Längengrads festgelegt. Damit war nicht nur Portugals Weg um Afrika nach Asien frei, sondern es hatte zugleich auch noch einen ordentlichen Happen von Südamerika für sich ergattert. Diesen spektakulären Erfolg hatte Johann II, seines Zeichens portugiesischer König, der geschickten Verhandlungsführung des Geografen, Astronomen und Seefahrers Duarte Pacheco Pereira zu verdanken. Vermutlich wusste Senhor Pereira bereits, dass der Nordosten Brasiliens, dessen Name dem rötlichen Holz, dem pau brasil geschuldet ist, weit über den 46. Längengrad nach Osten hin hinaus ragt. Somit hatte das kleine Portugal, sehr zum Ärger Spaniens, auch hier den Fuß in der Tür.
Die Tür aufzustoßen blieb dann auch konsequenter Weise dem Portugiesen Pedro Àlvares Cabral vorbehalten. Eine beachtliche Expeditionsflotte befehligend, landete er am 22. April 1500 nördlich der heutigen Stadt Porto Seguro im Bundesstaat Bahia. Folgerichtig nahm er das Land, da es ihm von keiner spanischen Kanone verwehrt wurde, für die portugiesische Krone in Besitz. Getreu seiner katholischen Konfession und in der Annahme, dass es sich lediglich um eine Insel handle, „taufte“ er sie kurzerhand Ilha da Vera Cruz (Insel des Wahren Kreuzes). Wahres Kreuz? Das hieße ja dann im Umkehrschluss, dass es womöglich auch ein unwahres Kreuz geben müsse? Na so was!
Eigentlich war ja Cabral in königlicher Mission nach Indien unterwegs. Um den beständigen Passatwind zu nützen – vor allem aber um den äquatorialen Kalmengürtel vor der westafrikanischen Küste zu umsegeln – schlug er auf dem Weg zum Kap der Stürme (Kap der Guten Hoffnung) einen großen Bogen nach Westen. Dabei kam ihm – bewusst oder unbewusst, das ist hier die Frage – Brasilien in die Quere. Wie dem auch war, die ostasiatischen Gewürzinseln hatten bei den königlichen Devisenbeschaffern erst einmal Vorrang. Das kleine Portugal schaffte es einfach nicht, auf allen Hochzeiten zugleich zu tanzen. Also legte man in Lissabon Cabrals Entdeckung erst einmal auf Eis…
Erst 30 Jahre später, zwischen 1530 und 1533 landeten die Portugiesen erneut mit fünf Schiffen und vier- bis fünfhundert Mann bei Pernambuco an. Unter ihrem Anführer, Martim Afonso de Sousa, vertrieben sie erst einmal die französischen Seeräuber und Holzhändler, die sich – den päpstlichen Vertrag nicht achtend – inzwischen eingenistet hatten. Anschließend segelte die Flotte längs der Küste südwärts. Schließlich ankerten sie vor den Gestaden des heutigen Bundesstaates Sao Paulo und gründeten am 22. Januar 1532 den Ort Sao Vicente, die erste europäische Siedlung in Brasilien. In die Heimat zurückgekehrt, erhielt Afonso de Sousa für seine Verdienste als effizienter Türöffner das Kapitanat Sao Vicente auf Lebenszeit.
So richtig aufgerissen, um nicht zu sagen aus den Angeln gehoben, wurde die Tür aber erst im 17. Jahrhundert. Die Bandairantes – so genannt wegen des Fähnleins, um das sie sich scharten – die nun vom Nordosten und auch aus dem Süden gleichermaßen das Landesinnere durchkämmten, kümmerte der Schiedsspruch des Papstes einen feuchten Kehricht. Die hatten weiß Gott mit anderen Widrigkeiten zu kämpfen, als dass sie sich auch noch mit so etwas Abstraktem wie unsichtbaren Meridianen abgeben mochten. Den Flussläufen folgend, stießen sie bis in die Quellgebiete des Parana und des Amazonas vor und machten so die päpstliche Bulle Inter caetera – die von den anderen Seemächten, Franzosen, Holländern und Engländern sowieso nie anerkannt wurde – endgültig zur Makulatur.
Die Triebkraft dieser „Banden“ war, wie sollte es auch anders sein, außer Abenteuerlust die Aussicht auf schnelles Geld: Geld in Form von eingefangenen Indios, die dringend als „Arbeitstiere“ auf den Zuckerohrplantagen des Nordostens gebraucht wurden. Die hohe Sterblichkeitsrate der Eingeborenen – die Begegnung mit den Weißen brachte ihnen so oder so den Tod – bedingte immer wieder neue „Expeditionen“. Nebenbei bemerkt: Das absehbare Versiegen des einheimischen Sklavenpotentials hatte konsequenter Weise die Einfuhr schwarzafrikanischer „Arbeitskräfte“ zur Folge. Deshalb ist es auch gar nicht weiter verwunderlich, dass heutzutage die schönsten Mädchen, von Belem bis Bahia, dunkelhäutig sind…
Den aus den südlichen Gebieten ins Landesinnere vorstoßenden Paulistas – Bürgern der Stadt Sao Paulo – blieb es vorbehalten, bei der schon recht einträglichen Jagd auf Indios auch noch Edelsteine und Edelmetall mit einzusacken. Das war relativ einfach, denn die bislang frei herumstreifenden Indios trugen diese Begehrlichkeiten als Amulette oder einfach nur als Schmuck zur Schau. Aber natürlich genügten den habgierigen Weißen die persönlichen Pretiosen ihrer unglücklichen Opfer nicht. Sie wollten mehr. Vor allem aber wollten sie über die Fundorte der Diamanten und Smaragde, des Silbers und des Goldes Bescheid wissen. Aber trotz „peinlicher Befragung“ – ich schätze, das kann man den von der „Heiligen Inquisition“ gegen jedwede Art von Menschlichkeit geimpften, iberischen Erzkatholiken ohne weiteres unterstellen – schwiegen sich die „Wilden“ darüber aus. Bartolomeus Bueno jedoch, ein gewiefter Sklavenjäger und listiger Fuchs, griff ob der Unwirksamkeit inquisitorischer Foltermethoden nicht sogleich zur Fingerquetsche. Er besann sich im Gegenteil eines Tricks und förderte vor einer zwangsversammelten Häuptlingsriege eine Flasche Hochprozentiges zu Tage. Davon schüttete er ein wenig in eine Schale und entzündete es. Der nebenbei vorgebrachte Hinweis, dass er mit all den Flüssen, an denen ihre Völker leben, ebenso verfahren werde, tat dann auch die gewünschte Wirkung. Dass ihm diese drastische Vorstellung unter den Einheimischen den etwas anrüchigen Beinamen Anhangüera (alter Teufel) einbrachte, dürfte ihn dabei kaum gestört haben. Reich an Beute und im Besitz unschätzbaren Wissens ging er als einer der erfolgreichsten „Paulistas“ in die Frühgeschichte dieser immer noch gewalttätigen Stadt ein…
Weil sich die Kunde von Gold bekanntlich schneller verbreitet als das Evangelium, wurde das „Gelobte Land“ – die heutigen Bundesstaaten Goias und Minas Gerais – dann auch alsbald von Goldsuchern aus dem Süden und dem Norden heimgesucht. Die Folge davon war aber nicht nur Mord und Totschlag, sondern auch die Gründung von Vila rica do Ouro Preto – die reiche Stadt des schwarzen Goldes. Der Terminus „schwarzes Gold“ hat aber nur indirekt mit den Negersklaven zu tun, die die siechen Indios als Arbeitstiere in den Minen schließlich ersetzen mussten, sondern ist auf den schwarzen Sand zurückzuführen, mit dem das am Fuße des Itacolomi gefundene Gold verunreinigt war.
Die Zeiten, in denen man die Nuggets wie Trüffel nur aus dem Sand zu buddeln brauchte, hielten naturgemäß nicht ewig vor. Letztlich musste man sogar danach graben und schürfen – aber doch mit beachtlichem Erfolg. Ich zitiere aus Wikipedia:
Zwischen 1730 und 1760 erreichte die Goldproduktion ihren Höhepunkt. Die portugiesische Krone nahm zwischen 1735 und 1751 34.275 Kilo Gold aus der Steuer ein, was einer jährlichen Produktion von 11 Tonnen Gold entsprach. Dieser Reichtum findet sich auch in der Architektur jener Epoche wieder, in der die berühmten Barockkirchen im Stile des Barroco Mineiro errichtet wurden. Der größte Bildhauer jener Zeit war Aleijadinh (1738 – 1814), einer der berühmtesten Söhne von Ouro Preto.
Aleijadinho, der Krüppel, hieß mit richtigen Namen Antonio Francisco Lisboa und war der Sohn eines weißen Herrn und dessen schwarzer Sklavin. Er war wohl der Schönste nicht. Dessen ungeachtet – oder vielleicht gerade deswegen – frönte er in seiner Jugend ausgiebig allen „männlichen“ Lustbarkeiten. Dass es einmal das Leid sein würde, das sein Leben ausmachte, war da noch nicht abzusehen. Ohne besondere Bildung und ohne Lehrmeister wurde er Bildhauer. Vermutlich war es das Erbe seiner Mutter, das ihn dazu befähigte. So wie seine afrikanischen Ahnen das Ebenholz kunstvoll bearbeiteten, so kunstvoll bearbeitete er den Seifenstein des Itacolomi und schuf so, über viele Jahre unentwegt arbeitend, all die beeindruckenden Plastiken, an denen Ouro Preto so reich ist.
Zu seinem nicht gerade schmeichelhaften Künstlernamen kam er, als ihm ab seinem 48. Lebensjahr das Schicksal seine Laster in Rechnung stellte. Der Suff, die Syphilis, die Lepra begannen nach und nach seinen Körper zu zerstören – sein Geist aber hielt noch viele Jahre stand. Verbissen arbeitete er, trank, arbeitete, trank und arbeitete, um den Schmerz zu betäuben. Sein Leib zog sich zusammen, die Lepra befiel sein wichtigstes Werkzeug – seine Hände. Um Daumen und Zeigefinger zu retten, entfernte er die übrigen Finger. Hammer und Meißel ließ er sich mit selbst gefertigten Prothesen an die Stümpfe schnallen. Als ihm auch noch die Beine versagten, musste ihn sein Sklave von der Werkstatt zur Arbeitsstelle tragen. Das Geld, das ihm die Aufträge der Reichen und der Kirche einbrachten, verschenkte er an die Bedürftigen – bis auf den Rest, den er fürs Trinken brauchte. Trotz seines Siechtums wurde er über 70 Jahre alt. Sein Ende erwartete er in einer seiner schönsten Kirchen, der Igreja Sao Francisco Assis (?). Seine letzten Worte sollen diese gewesen sein: „Komm Schmerz, bleibe bei mir, denn du bist der einzige, der mich versteht, du hast mich niemals verlassen und du wirst zurückbleiben, wenn ich jetzt davon gehe, denn du bist ewig und das einzige Erbteil der Menschen. Vielleicht verdanke ich dir alles, mein ganzes Werk!“ Dieses Werk, eine Vielzahl sakraler Plastiken, Reliefs und nicht zuletzt die berühmten Prophetenskulpturen vor der Kirche unseres guten Herrn Jesus vom Wäldchen (Igreja do bom Jesus do Matoshino), macht die Stadt zum Kunstwerk. Inzwischen wurde sie zum UNESCO-Weltkulturerbe erhoben und ist nun einer der wichtigsten Touristenmagnete Brasiliens.
Lesen Sie im Buch weiter!
á 13,90 €
Bestellung
Leseprobe:
1787 kehrt Bligh auf Betreiben seines Förderers Sir Joseph Banks in den Dienst der Admiralität zurück. Sir Banks, Präsident der Royal Society, hatte die glorreiche Idee, den auf Tahiti beheimateten, anspruchslosen Brotfruchtbaum auch auf den karibischen Inseln zu verbreiten. Dort herrschte nämlich seinerzeit große Not, weil die feudalen Inselherren wegen der ausbleibenden Getreidelieferungen aus der abgefallenen amerikanischen Kolonie kein Futter mehr für ihre „Arbeitstiere“ hatten. Sprich: Die schwarzen Sklaven verhungerten so nach und nach. Das wirkte sich natürlich auch auf’s Geschäft aus, und der lukrative Handel mit Zucker und Rum drohte zum Erliegen zu kommen. Dem musste vorgebeugt werden. Der fruchtbare Brotfruchtbaum mit bis zu drei Ernten im Jahr versprach da Abhilfe. Seine Frucht, die aussieht wie eine pockennarbige Papaya, enthält bis zu 24 kastaniengroße Nüsse. Diese stärkehaltigen Samenkerne lassen sich, geröstet und zermahlen, wie gemeines Mehl zu Brot verarbeiten. Daher der Name dieses immergrünen Baumes, der zur Gattung der Maulbeergewächse zählt.
Stecklinge dieses Baumes sollten den karibischen Großgrundbesitzern nun aus der Bredouille helfen. King Georg III., dem natürlich auch sehr viel am gewinnbringenden Überseehandel lag, erließ im Mai 1787 eine dementsprechende Order an die Admiralität. Der Admiralität allerdings war dieser rein kommerzielle Auftrag, bei dem für die Marine weder Ruhm noch Ehre zu holen war, nicht besonders genehm. So setzten sie für das Brotfrucht-Unternehmen lediglich einen kleinen, noch umzubauenden Kohlenfrachter ein. Sobald das 27,7 m lange und 7,3 m breite Schiff zum „segelnden Treibhaus“ umgerüstet und wieder seetüchtig war, erhielt es den Namen BOUNTY.
Am 23. Dezember 1787 stach die BUNTY von Spithead aus in See und nahm nach einem Zwischenaufenthalt in Santa Cruz de Teneriffa Kurs auf Kap Hoorn. An dieser Stelle erscheint es mir angebracht, auch noch ein paar Worte über den Namen dieses berüchtigten Kaps zu verlieren. Denn wenn Patagonien auf der Landkarte auch die Form eines Hornes hat, so hat das dennoch nichts mit dem Namen des Kaps zu tun. Auch war Francis Drake, so wie die Briten es darstellten, nicht der Erste, der das südlichste Ende der Neuen Welt vor Augen hatte. Diese Ehre gebührt Willem Cornelisz Schouten, einem niederländischen Seefahrer aus der kleinen niederländischen Stadt Hoorn...
Zurück zur BOUNTY und ihrem Captain. Eigentlich sah der vorgeschriebene Routen-Plan ja vor, Tahiti über Kap Hoorn zu erreichen. Anschließend sollte über die Torres-Straße Java angelaufen werden, um dort weitere Pflanzen aufzunehmen. Über das Kap der Guten Hoffnung sollte das Schiff dann in die Karibik gelangen und dort die Stecklinge – gegen Rum tauschen.
Nun aber war der Zeitpunkt für eine Umschiffung von Kap Hoorn, noch dazu in westlicher Richtung, denkbar schlecht gewählt. Einen ganzen Monat lang, vom 23. März bis 22. April, versuchte Bligh, die Admiralitäts-Order befolgend, trotz aller Widrigkeiten des Wetters das Kap zu bezwingen. Eigentlich unvorstellbar! Dreißig Tage lang, unaufhörlich im Sturm hin und her kreuzend, ohne vorwärts zu kommen – dass muss die reine Hölle gewesen sein. Und sicher war es wie eine Erlösung für die geschundene Besatzung, als sich Bligh endlich entschloss, nicht gegen, sondern mit dem Wind zu segeln. Das heißt, das Ziel sollte nun über das Kap der Guten Hoffnung erreicht werden. Das gelang dann ja auch – nach mehreren Zwischenstopps und mit etwas Verspätung. Am 25. Oktober 1788 ging das Schiff in der Matavai-Bucht von Tahiti vor Anker. Weil aus biologischen Gründen – die Brotfruchtbäume befanden sich gerade in einer Ruhephase – keine Stecklinge zu haben waren, zog sich der Aufenthalt in die Länge. Die ausgelaugte, „ausgehungerte“ Mannschaft genoss das Leben an Land, zumal ihr die Einheimischen freundlich gesonnen waren. Einige von ihnen, darunter auch Christian Fletcher, erlagen dem Charme der Naturschönheiten so sehr, dass sie auch vor festen Bindungen nicht zurückscheuten. Im Nachhinein betrachtet, mochte vielleicht gerade dies der wahre Grund der Meuterei gewesen sein. Jedenfalls verfiel die Disziplin so sehr, dass Bligh – nach einem schwerwiegenden Vergehen – Diebstahl eines Beibootes und versuchter Desertion – die „Neunschwänzige Katze“ sprechen ließ. Doch ansonsten wird Bligh neuerdings – ganz anders als bislang in Literatur und Film – als ein eher humaner Vorgesetzter dargestellt. Zum Beispiel hätte er für den Diebstahl des Beibootes die Täter auch hoch an der Rah baumeln lassen können. Der Umstand aber, der meinen Meinungswechsel zu seinen Gunsten auslöste, ist das Wachsystem, das er auf der BOUNTY einführte. Das heißt, dass er das in der Royal Navy gängige Zwei-Schicht-System – vier Stunden Wachdienst, vier Stunden Schlaf – auf ein Drei-Schicht-System – vier Stunden Wache und acht Stunden Freizeit – umgestellt hatte. So eine gravierende Änderung eines an sich starren Systems spricht für Fortschrittlichkeit und Humanität, egal welche Gründe Bligh bewegt haben mochten. Aber wie man weiß, seine ihm anvertrauten Leute haben es ihm nicht gedankt.
Am 24. April 1789 war es dann endlich so weit, mit 1.015 Stecklingen, die viel Platz und auch viel Wasser brauchten, nahm die BOUNTY Kurs auf die Meerenge zwischen Neuguinea und Australien. Zwischendurch steuerte er Nomuka auf Tonga an, um Proviant und Wasser zu ergänzen, so wie es schon Tasman und Cook vor ihm gemacht hatten. Dabei kam es zum Streit mit den Insulanern, weil diese auch andere, nicht zum Tausch vorgesehene Gegenstände mitgehen ließen. Als Gegenmaßnahme nahm Bligh Geiseln. Das aber beeindruckte die moralisch etwas anders gepolten Insulaner wenig. Bligh, vielleicht in Erinnerung an die „Todesursache“ James Cooks, verzichtete darauf, ein Exempel zu statuieren und ließ sie ohne Gegenleistung wieder frei. Im Übrigen machte er niemand anderen als Christian Fletcher für den Vorfall verantwortlich. Das dürfte den jungen Mann – eh schon traumatisiert durch den Verlust seiner „Traumfrau“ – zusätzlich erbost haben. Außerdem beschuldigte ihn Bligh, sich am Schiffsproviant vergriffen zu haben. Da war für Fletcher das Maß voll.
Das alleine hätte für eine offene Meuterei aber natürlich noch lange nicht gereicht. Einer der Gründe war sicher auch die Enge an Bord. Die Männer, es waren noch, wenn ich mich nicht verrechnet habe, ihrer 43, hatten für sich und ihre Bedürfnisse nur sehr wenig Raum zur Verfügung. Selbst diesen mussten sie ja auch noch mit den pflegebedürftigen, stets durstigen Pflanzen teilen. Ein anderer Grund war vielleicht die unterschwellige Trauer um das „verlorene Paradies“. Für diese Annahme spricht, dass die Meuterer unter Fletschers Führung sich eigentlich nur der Barkasse bemächtigen wollten, um damit nach Tahiti zurückzukehren. Weil das aber so ohne weiteres nicht möglich war, blieb ihnen nichts anderes übrig, als den Spieß umzudrehen. Man darf also annehmen, dass es kein von langer Hand vorbereiteter Aufstand, sondern eher eine spontane, unüberlegte Aktion einiger disziplinloser Besatzungsmitglieder war. Auslöser waren wohl Rationierungsmaßnahmen an Proviant und Trinkwasser, zu denen sich der Schiffsführer angesichts der fehlgeschlagenen Nachversorgung gezwungen sah. Somit kann der 2. Offizier Christian Fletcher, der sich nur zu bereitwillig den Einflüsterungen der Unzufriedenen ergab, nicht länger mein Held mehr sein! So oder so, jedenfalls brachten die Meuterer in den frühen Morgenstunden des 29. April 1789 das Schiff südlich von Tofua (Tongainseln) vollständig unter ihre Kontrolle.
Bligh und seine Getreuen, 18 an der Zahl, wurden in die Barkasse verfrachtet und notdürftig mit Proviant und Frischwasser versorgt – versorgt mit zusätzlich gewonnenem Wasser, weil die wassersüchtigen Stecklinge einfach über Bord geworfen wurden; da konnten die sich mal richtig vollaufen lassen. Ferner überließ man dem ausgesetzten Captain auch noch seine Navigationsgeräte. Das sollte sich rächen. Bligh war ein hervorragender Navigator und schaffte es, im offenen Boot – Wind, Sonne und Seegang völlig ungeschützt ausgeliefert – eine Strecke von über 5.800 Kilometern zurückzulegen.
Lesen Sie im Buch weiter!
Informationen zu den maritimen Büchern des Webmasters finden Sie hier:
zur gelben Zeitzeugen-Bücher-Reihe des Webmasters:
© Jürgen Ruszkowski

zur gelben Zeitzeugen-Bücher-Reihe des Webmasters:
© Jürgen Ruszkowski
Maritime books in German language: fates of international sailors
Los libros marítimos en el idioma alemán: los destinos de marineros internacionales:
zu meiner maritimen Bücher-Seite
navigare necesse est!
Maritime books in German language: fates of international sailors
Los libros marítimos en el idioma alemán: los destinos de marineros internacionales:
Diese Bücher können Sie direkt bei mir gegen Rechnung bestellen: Kontakt:
Zahlung nach Erhalt der der Ware per Überweisung.
Informationen über die Buchpreise finden Sie auf der Bücher-Seite
Zahlung nach Erhalt der der Ware per Überweisung.
Bücher in der gelben Buchreihe" Zeitzeugen des Alltags" von Jürgen Ruszkowski:
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
Alle Bände (außer Band 9) gegen Vorkasse auch als epub-ebook für 10 € oder als kindle-ebook für ca. 8 € bei amazon - hier reinschauen! - bei amazon - bei amazon - bei amazon
|
Band 1 - Band 1 - Band 1
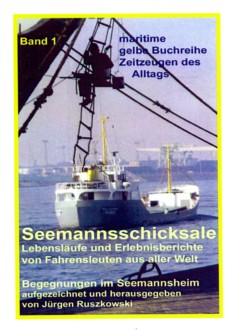
á 13,90 €
Bestellung
kindle- ebook für ca. 8 € bei amazon
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks-
B00AC87P4E
|
Band 2 - Band 2 - Band 2
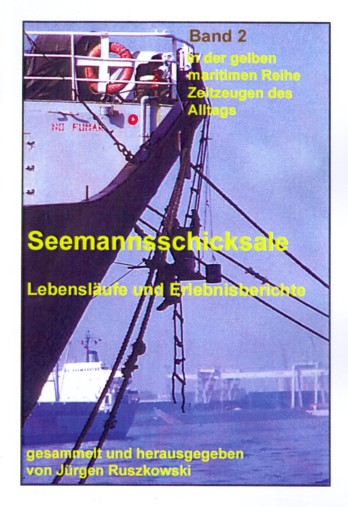
€ á 13,90
kindle-ebook für ca. 8 € bei amazon
auch als kindle-ebook bei amazon
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
B009B8HXX4
|
Band 3 - Band 3

á 13,90 € - Buch
auch als kindle-ebook bei amazon
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
B00998TCPS
|
|
Band 4 - Band 4 - Band 4
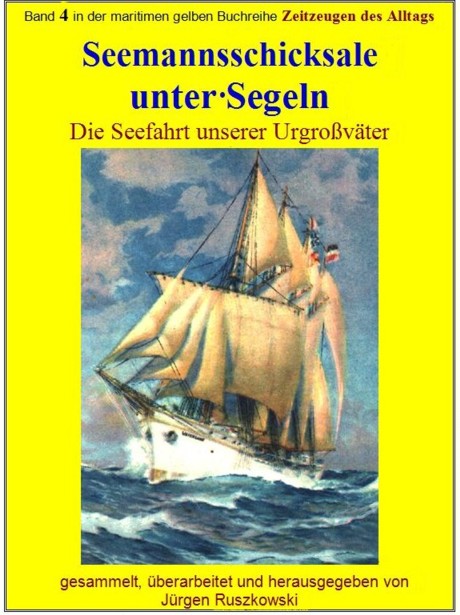
á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 5 - Band 5
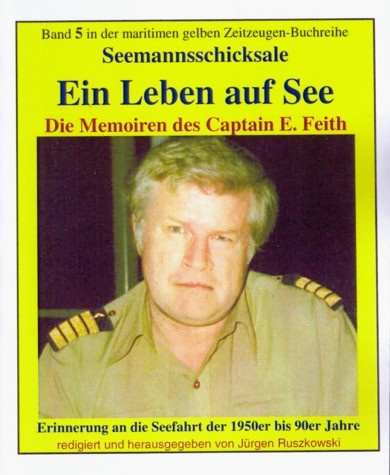
á 13,90 €
Bestellung
kindle-ebook für ca. 8 € bei amazon
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 6 - Band 6
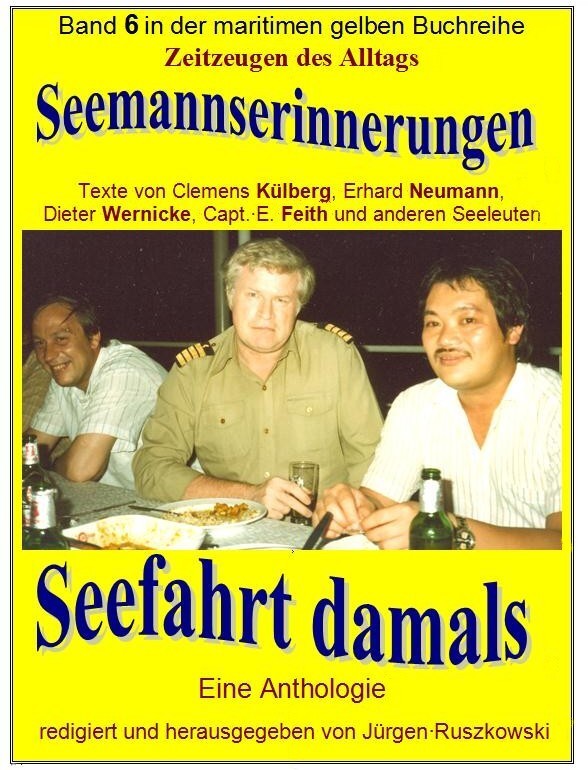
á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
|
Band 9 - Band 9
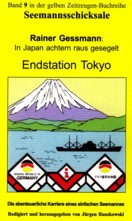
á 13,90 €
Bestellung
|
Band 10 - Band 10
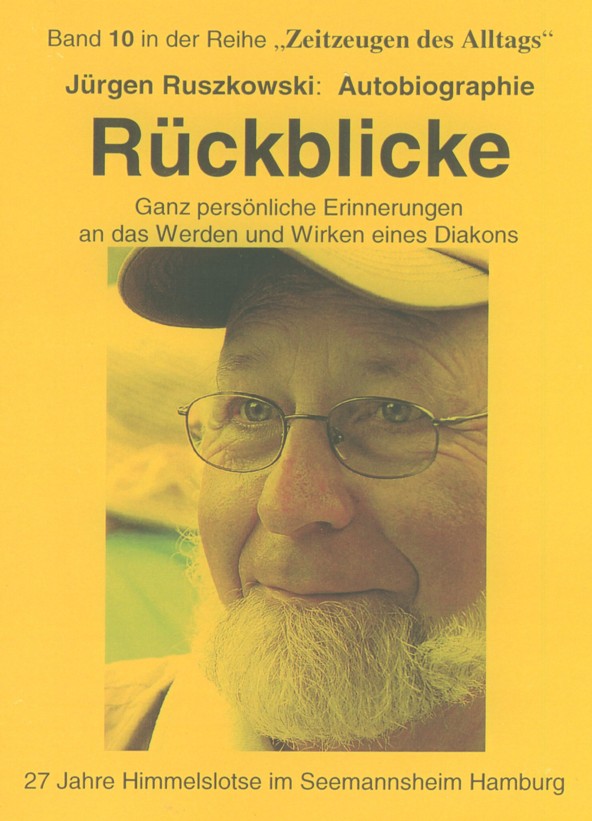
á 13,90 €
Bestellung
kindle-ebook für nur ca. 4,80 € bei amazon
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 11 - Band 11
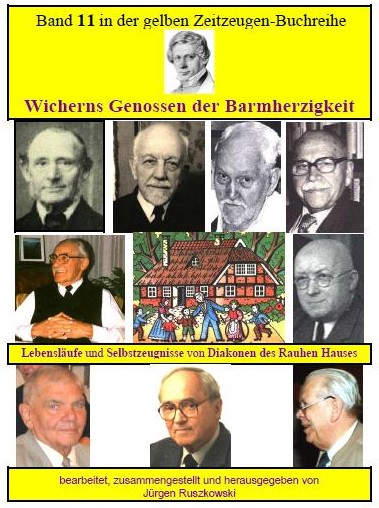
á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
|
Band 12 - Band 12

Diakon Karlheinz Franke
leicht gekürzt im Band 11 enthalten
á 12,00 €
eventuell erst nach Neudruck lieferbar
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 13 - Band 13
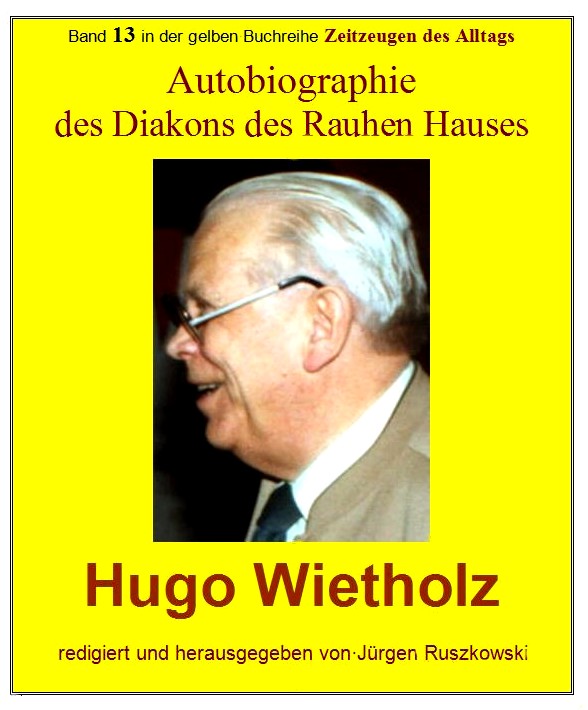
gekürzt im Band 11 enthalten
á 13,90 €
Bestellung
kindle-ebook für ca. 5 € bei amazon
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 14 - Band 14

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
|
Band 15 - Band 15
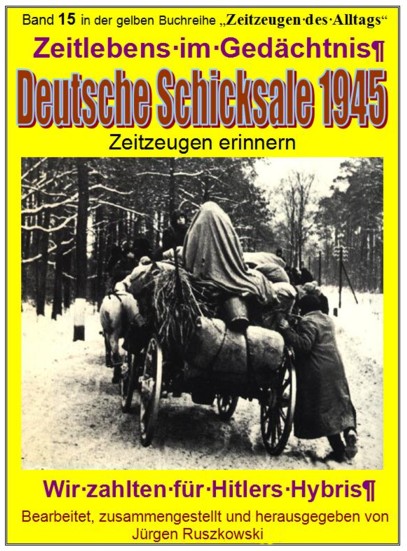
á 13,90 €
Bestellung
kindle-ebook für ca. 8 € bei amazon
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 17 - Band 17
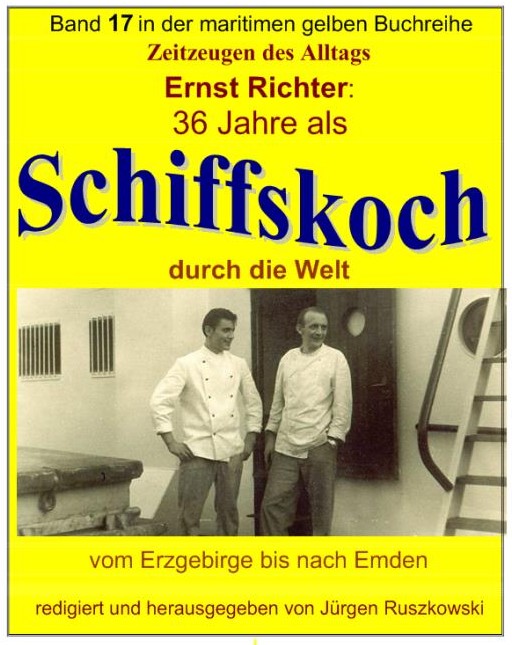
á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 18 - Band 18

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
|
Band 19 - Band 19

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 20 - Band 20
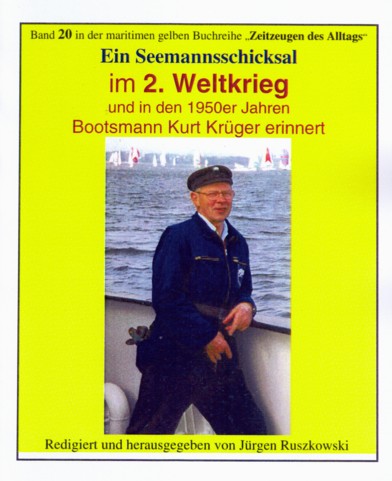
á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 21 - Band 21

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
|
Band 22 - Band 22

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 23 - Band 23

á 12,00 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 24 - Band 24
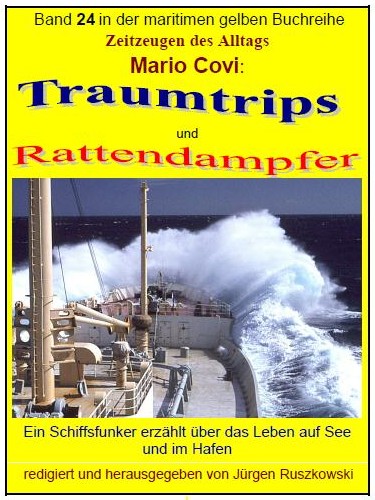
á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
|
Band 25 - Band 25
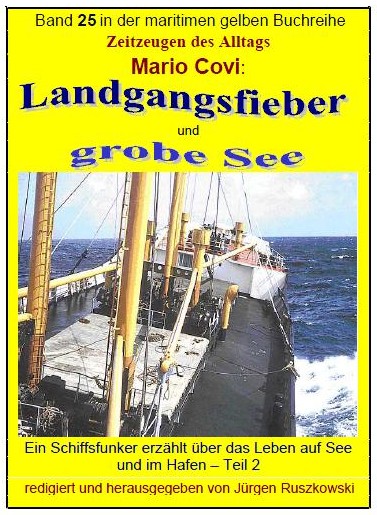
á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 26 - Band 26

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 27 - Band 27

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
|
Band 28 - Band 28

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 29 - Band 29
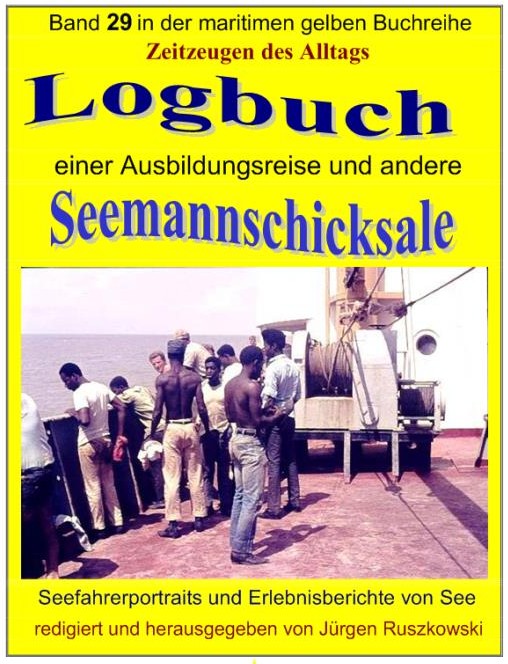
á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 30 - Band 30
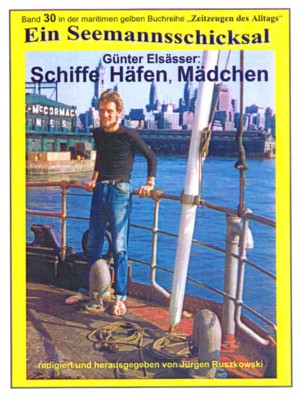
á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
|
Band 31 - Band 31

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 32 - Band 32
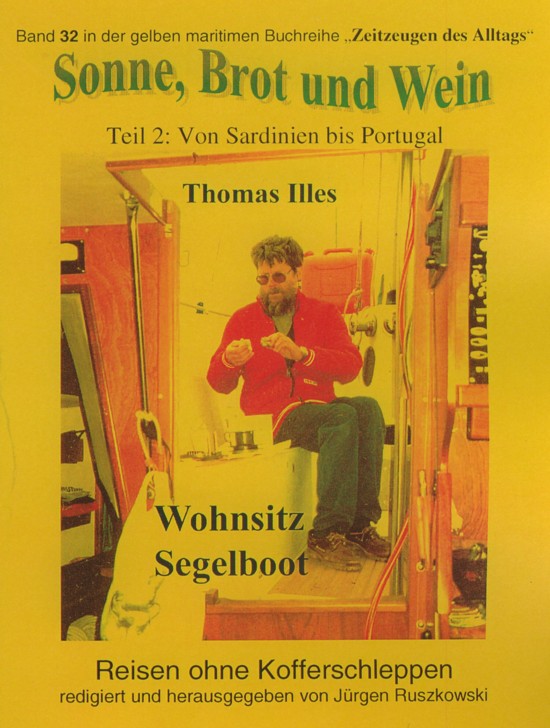
á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 33 - Band 33

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
|
Band 34 - Band 34

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 35 - Band 35

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 36 - Band 36

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
|
Band 37 - Band 37

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 38 - Band 38

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 39 - Band 39
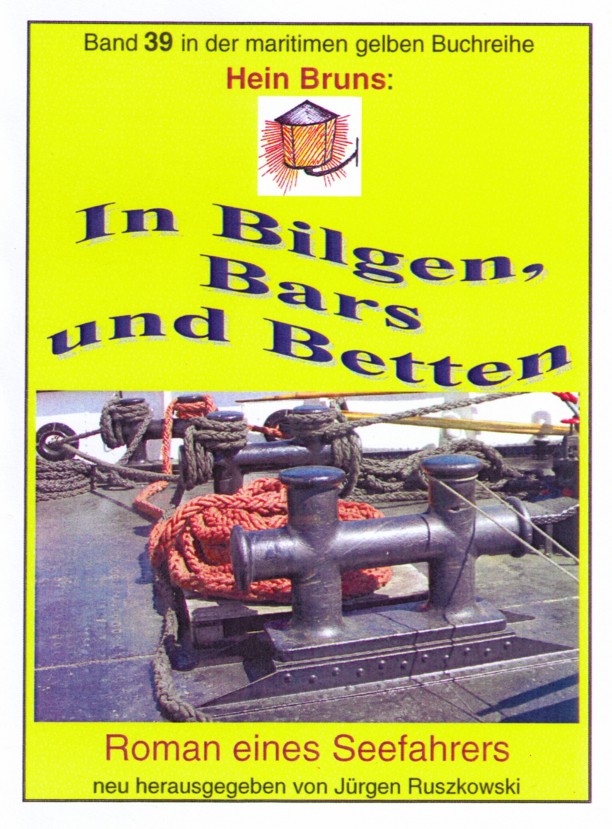
á 13,90 €
Bestellung
kindle-ebook für ca. 8 € bei amazon
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
|
Band 40 - Band 40

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 41 - Band 41

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 42 - Band 42

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
|
Band 43 - Band 43 - Band 43

á 12,00 €
Bestellung
kindle-ebook für ca. 5 € bei amazon
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 44 - Band 44 - Band 44

á 13,90 €
Bestellung
kindle -ebook für ca. 8 € bei amazon
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 45 - Band 45 - Band 45
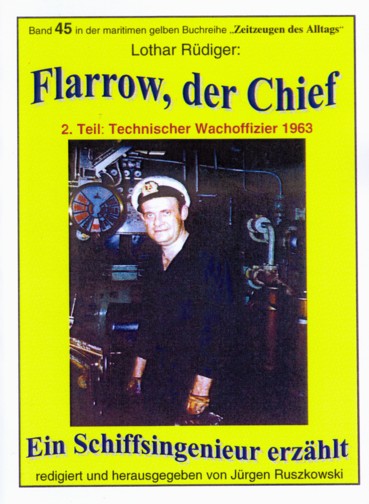
á 13,90 €
Bestellung
kindle -ebook für ca. 8 € bei amazon
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
|
Band 46 - Band 46 - Band 46
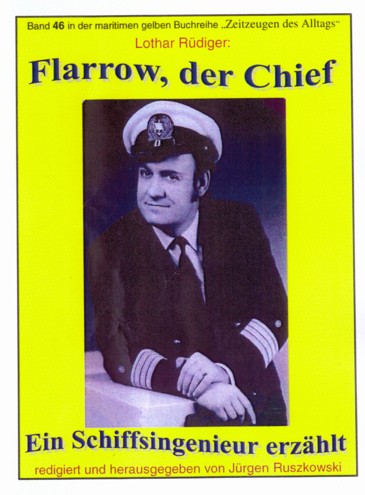
á 13,90 €
Bestellung
kindle -ebook für ca. 8 € bei amazon
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 47 - Band 47 - Band 47

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 48 - Band 48

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
|
Band 49 - Band 49 - Band 49

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 50 - Band 50 - Band 50

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
. Band 51 - Band 51 - Band 51

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
|
Band 52 - Band 52

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 53 - Band 53

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 54 - Band 54
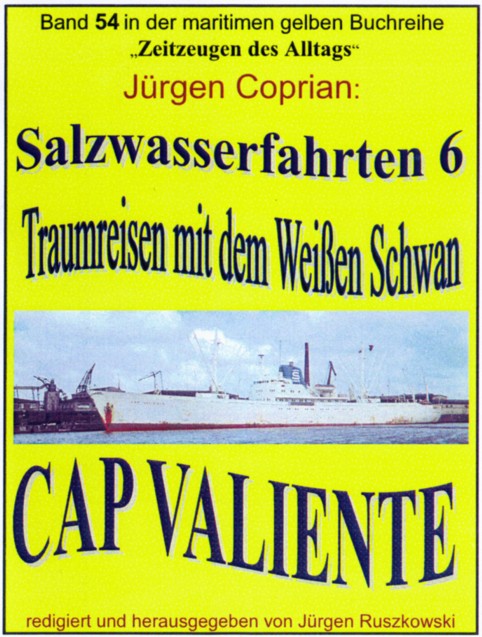
á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
|
Band 55 - Band 55

á 13,90 €
Bestellung
auch als kindle- ebook für ca. 8 € bei amazon
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 56 - Band 56

nicht mehr lieferbar
|
Band 57 - Band 57 - Band 57

á 14,90 €
Bestellung
kindle-ebook für ca. 8 € bei amazon
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
|
Band 58 - Band 58 - Band 58

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 59 - Band 59

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 60 - Band 60
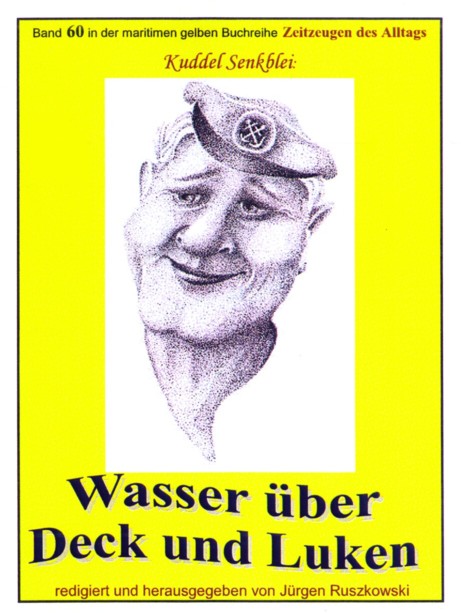
á 13,90 €
Bestellung
kindle-ebook für ca. 8 € bei amazon
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
|
Band 61 - Band 61
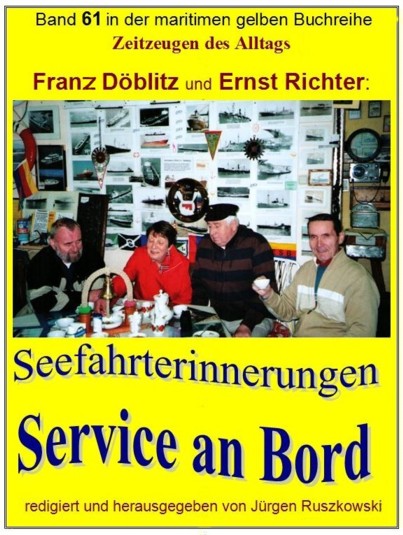
á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
Band 62 - Band 62

á 13,90 €
Bestellung
kindle-ebook für ca. 8 € bei amazon
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
|
- Band 63 - Band 63 -

á 13,90 €
Bestellung
Ruszkowskis amazon-kindle-ebooks
hier könnte Ihr Buch stehen
|
|
Band 64 -

á 13,90 €
Bestellung
- kindle-ebook -
|
Band 65 - Band 65 - Band 65 -
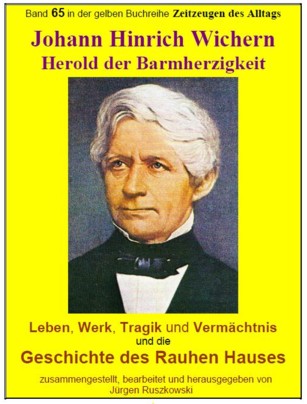
Johann Hinrich Wichern
á 13,90 €
Bestellung
hier könnte Ihr Buch stehen
|
- Band 66 - Band 66 - Band 66
Bernhard Schlörit:
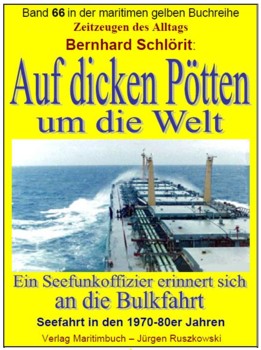
- Auf dicken Pötten um die Welt -
á 13,90 €
Bestellung
|
|
- Band 67 - Band 67 -

Schiffsjunge 1948-50
á 13,90 €
Bestellung
kindle-ebook bei amazon
für 7,60 € oder 10,29 US$
|
Band 68 - Band 68 -
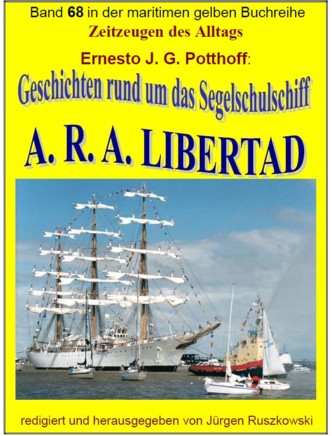
Ernesto Potthoff:
Segelschulschiff LIBERTAD
f0r 7,60 € oder 10,29 US$
|
Band 69 - Band 69 - Band 69 - Band 69

Teil 1 der Trilogie von
Ernst Steininger
Seemann, deine Heimat ist das Meer
á 13,90 €
ebook für 7,49 € oder 10,29 US$
---
Band 70 - Band 70 - Band 70 -

á 13,90 €
Bestellung
- - -
Band 71 - Band 71 -
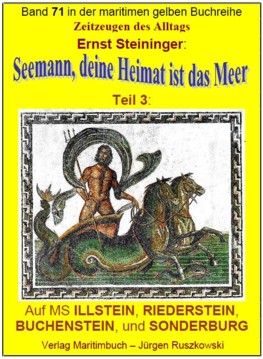
á 13,90 €
Bestellung
hier könnte Ihr Buch stehen
alle Bücher ansehen!
|
je Buch 13,90 € (Band 57 = 14,90 € - Bände 9 + 23 = 12 €) innerhalb Deutschlands portofrei gegen Rechnung - Bestellungen
Buchbestellungen
Kontaktformular
Bestellung
Gesamtübersicht über viele Unterseiten auf einen Blick
weitere websites des Webmasters:
Diese website existiert seit dem 8.03.2014 - last update - Letzte Änderung 9.03.2013
Jürgen Ruszkowski © Jürgen Ruszkowski © Jürgen Ruszkowski
|

